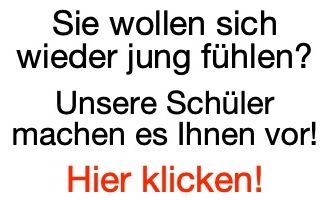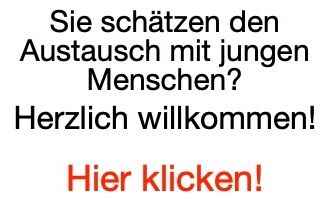Mein Werdegang durch die Stationen des Rauhen Hauses in Hamburg 1953 bis 1960
Durchbeißen in geistlicher Ödnis und Ausbildung durch Ausbeutung
(aufgezeichnet im Dezember 2014 auf der Grundlage von Erinnerungen, Tagebüchern, Korrespondenzen und Beurteilungen durch Dritte; diese jeweils besonders gekennzeichnet)
Meine religiöse Einstellung und mein evangelisch-christlicher Glaube, der seine ersten Ursprünge durch einen musischen und leicht religiösen Hintergrund seitens meiner Großmutter mütterlicherseits sowie meiner Mutter einen Boden fand , wurde im Vor- und Hauptkonfirmandenunterricht bei dem Castroper Pastor, Martin Nelle, deutlich gestärkt.
Meine Konfirmation 1950 hatte allerdings einen sehr traurigen Hintergrund. Zwei Tage vor der herbeigesehnten Einsegnung, zu der ich „mein Herz Jesus schenken“ wollte, schlug mein total betrunkener Vater meine Mutter nieder, schlug ihren Kopf mehrfach auf einen Steinfußboden, so dass sie am Konfirmationstag mit grün und blau verfärbtem Gesicht und mein Vater kreidebleich mich zur Kirche begleitete. Während meine Klassenkameraden mit ihren Eltern – alle festlich gekleidet und mit fröhlichen Gesichtern – dem Fest entgegen gingen, war ich voller Verzweiflung und Düsternis und schämte mich meiner Eltern.
Infolge der misslichen häuslichen Verhältnisse – mein Vater war Alkoholiker, meist arbeitslos und unkontrolliert in seinen Reaktionen, schlug meine Geschwister und mich mit dem Stock - herrschte in mir oft das, was man heute gern als Depression bezeichnet.
Meine Frömmigkeit hielt an. Ich trat in den CVJM ein, besuchte viele Veranstaltungen und machte kleine Fahrten, so z.B. zum Essener Kirchentag 1950 . Gute Rhetoriker und Prediger wie z.B. der Pfarrer Busch, Martin Niemöller u.a. beeindruckten mich sehr. Aber die beengten Verhältnisse, in denen wir lebten – wir waren zwangseingewiesene Flüchtlinge aus Pommern – und die Tragödie im Elternhaus ließen meine Leistungen auf dem Gymnasium immer schlechter werden. Es drohte, als ich 16 Jahre alt, ein Sitzenbleiben. Dem wollte ich entgehen, weil ich die nachfolgende Tragödie, die mein Vater mit Sicherheit inszeniert und die mich vollends zerstört hätte, nicht erleben wollte. Ich besprach mich mit meinem Konfirmationspastor, der mir eine Ausbildung zum Diakon im Rauhen Haus in Hamburg empfahl. Seine Empfehlung:
Ev.Luther.-Kirchengemeinde Castrop-R., den20.11.1952
Pfarramtl. Zeugnis
Norbert Mieck, geb. am 29.2.1936, ist Ostern 1946 in meinen kirchlichen Unterricht aufgenommen und Ostern 1950 von mir konfirmiert worden. Er war ein besonders interessierter und für religiöse Fragen aufgeschlossener Schüler. Seine gelegentlichen kleinen Gedichte trugen zur Bereicherung der Festzeiten im Kirchenjahr bei. Nach seiner Konfirmation hat er als Mitglied des CVJM sich sehr rege an allen kirchlichen Veranstaltungen beteiligt. Über seine augenblicklichen Beschäftigung im Bergbau ist seine Liebe zur Inneren Mission nicht erkaltet; er studiert z.Z. die beiden Bände der Biographie Wicherns von Oldenburg.
Gez. Nelle Pfr.
Ich hatte aber noch nicht das Eintrittsalter (17 Jahre) erreicht, so dass ich ein knappes Jahr überbrücken musste. In dieser Zeit arbeitete ich als Jungbergmann auf der Zeche Erin in Castrop-Rauxel und besuchte regelmäßig die Veranstaltungen des CVJM und die sonntäglichen Gottesdienste.
Das erste Jahr in der Diakonenausbildung
Ich bewarb mich im Rauhen Haus und wurde am 2. März 1953 aufgenommen. Ziel war die Ausbildung zum Diakon und Sozialarbeiter. Zunächst musste ich ein Vorpraktikum ableisten und war – wie es damals hieß – Hausbruder. Mir wurden – ohne Anleitung – folgendes Aufgaben übertragen: Heizkesselversorgung für drei große Häuser, Mittagessentransport für das Altenheim, Einsatz nach Bedarf, z.B. Gartenarbeit oder alte Männer aus dem Altenheim des R.H. baden.
Nach Aufgabenerfüllung war ich mir selbst überlassen, ging zwar pflichtgemäß wie alle anderen Brüder und Zöglinge auch abends in den Andachtssaal zu einer kurzen Andacht mit Lied und Gebet.
Die Zöglinge des Internats, nur Jungen, die auf verschiedene Schulen außerhalb des R.H. gingen, waren in sog. Familien je nach Altersgruppe eingeteilt. Es gab auch eine Familie, in der die Hartgesottenen, die Schwierigen zusammengefasst waren. Je Familie gab es einen Familienleiter und einen Gehilfen. Der Familienleiter war i.d. Regel in der Ausbildung weiter als der Gehilfe. Untergebracht waren sowohl die Zöglinge als auch die Brüder in alten Gebäuden oder einer Baracke. Die Brüder schliefen meist mit den Kindern oder Jugendlichen in einem Raum, meist mit Doppelstockbetten ausgestattet. Morgens war recht zeitig Wecken angesagt und dann gemeinsames Frühstück in einem großen Speisesaal mit Eingansgebet.
Es war im Grunde ja noch Nachkriegszeit, und so war auch die Ernährung einfach und karg. Es gab jeden Morgen den sog. Missionskäse, der als Spende aus den USA kam. Und die Milchspeisen wurden aus gespendeter Trockenmilch bereitet.
Wir jungen Brüder hatten noch keinen geregelten Unterricht und wurden auch nicht in der Familienarbeit- bzw. Erziehungsarbeit eingesetzt. Sporadisch gab es mal Angebote von einem Tanzlehrer, der uns nicht das Tanzen, sondern Anstandsregeln beibringen sollte. Und wir hatten eine Anleitung zum Schreibmaschinenschreiben.
Das Verhältnis der jungen Brüder zu denen, die schon im Unterricht waren, war ein distanziertes. Man siezte sich. Nur wir jungen Brüder duzten uns schnell und tauschten uns auch aus. Es gab viel Enttäuschung unter den neuen Brüdern, die ein frommeres Leben erwarteten, über die Distanziertheit seitens der älteren Brüder, über die viele Arbeit, die zu tun war und über die geistliche Kargheit. Während meines ersten Jahres traten von den neu hingekommenen Brüdern ca. 50% nach wenigen Monaten wieder aus. Ich führte damals eine entsprechende Liste. Neben freier Kost und Unterkunft bekam ich im ersten Monat 10 DM Taschengeld, später 20 und 30 Mark.. Die Brüder, die schon im Erziehungsdienst waren, bekamen mehr.
Da ich im Verhältnis zu anderen Anfängern sehr jung war, mutete man mir ein zweites Jahr Vorpraktikum zu. Dies sollte im Städt. Versorgungsheim Cuxhaven stattfinden, das von einem Rauhhäusler Diakon namens Paul Schönau geleitet wurden. Das Heim bestand aus einem Altenheim, einer Säuglingsstation, einer Kleinkindergruppe, einer Schulkindergruppe und einem landwirtschaftlichen Betrieb.
Pastor Donndorf, der Leiter des Rauhen Hauses, schrieb am 8. April 1954 an Diakon Paul Schönau (so entnommen der Brüderakte des Rauhen Hauses):
Lieber Bruder Schönau,
Ich habe von Bruder Jahnke gehört, dass Sie um einen Gehilfen gebeten haben. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir in der Lage waren, Ihrer Bitte zu entsprechen. Bruder M i e c k, der für Sie bereitgestellt ist, ist am 29. 2. 36 geboren und am 2. 3. 1953 bei uns eingetreten. Er hat hier die Funktion eines Hausbruders versehen und hat sich dabei gewissenhaft, fleißig und lernwillig gezeigt. Die Schwierigkeit, die wir immer wieder mit ihm hatten, lag darin, dass es ihm fast unmöglich war, die Distanz zu den Mädchen zu halten. Sie müssen das wissen, damit sie ihn vor sich selbst schützen können. Ich möchte Sie also herzlich bitten, sein Privatleben und seinen Verkehr mit dem anderen Geschlecht unter Augen zu haben. Sie können ihm einen großen Hilfsdienst erweisen, wenn Sie aus diesem Kind einen Mann machen. Ich bitte Sie herzlich, ihn nicht sich selbst zu überlassen, sondern sich seiner anzunehmen. Sie können dann eine große Hilfe an ihm haben. Bitte, lassen Sie mich wissen, wann er seinen Dienst antreten soll.
Mit brüderlichem Gruß,
Ihr (gez. Donndorf)
Hierzu ist von meiner Seite folgendes klarzustellen:
Ich hatte während dieses ersten Jahres im RH zwar freundschaftlichen Kontakt zu den weiblichen Angestellten, aber weder eine „Beziehung“ noch eine Freundschaft gehabt, etwa dass man sich regelmäßig traf. Vielleicht hatten die anderen Brüder eine größere Distanz zu den jungen Mädchen bzw. Frauen gehabt als ich. Schließlich kam ich aus einer Familie mit zwei Schwestern und war den Umgang mit jungen Mädchen gewohnt und hielt dies auch für selbstverständlich.
In diesem ersten Jahr fand keinerlei geistliche Betreuung statt. Ich blieb mir selbst überlassen. Ich ging nur jeden Abend – wie alle Brüder und Zöglinge – zur Abendandacht. Das war so etwas wie eine Pflichtveranstaltung.
Meine Abordnung nach Cuxhaven durch Pastor Donndorf hatte unter seinem Hinweis, dass es mir „fast unmöglich war, die Distanz zu den Mädchen zu halten“ folgende ironische Konsequenz: In Cuxhaven gab es neben dem Heimleiter Schönau nur noch als männliche Personen: den landwirtschaftl. Verwalter und den Hausmeister. Ansonsten nur weibliches Personal: Kinderkrankenschwestern, Krankenschwestern, die Küchenchefin, Kindergärtnerinnen, Kinderpflegerinnen und etwa sechs bis acht junge z.T. hübsche Praktikantinnen, die später soziale Berufe ergreifen wollten. Ich unterstelle, dass Pastor Donndorf mich nicht absichtlich in ein Fegefeuer stecken wollte, sondern keinerlei Ahnung hatte, wie das Versorgungsheim in Cuxhaven personell besetzt war. Er hatte lediglich auf eine persönliche Bitte von Brd. Jahnke, dass Brd. Schönau dringend einen Gehilfen suchte, reagiert.
Zusammenfassend ist über das erste Jahr in der Diakonenausbildung zu sagen, dass es keinerlei geistliche Betreuung oder Beistand gab, keine persönlichen unterstützenden Gespräche stattfanden. Es gab lediglich Tischgebete und abends eine Andacht für alle, also auch für die Zöglinge, die im Internat untergebracht waren (z.T. noch in Baracken und 6- oder 8- Bettzimmern) und deren Eltern – wie man hörte – sehr hohe Internatskosten bezahlen mussten.
Zweites Jahr der Ausbildung: Praktikum im Städtischen Versorgungsheim
In diesem Jahr in Cuxhaven (1954 bis 1955) habe ich viel gelernt. Zum einen saß ich vormittags zusammen mit dem Heimleiter Schönau in seinem Büro, lernte Schreibmaschine schreiben, Post zu erledigen, Statistiken und Karteien zu führen bzw. weiter zu entwickeln. Ich lernte auch, die Post an die ihm übergeordnete Stelle, das Sozialamt Cuxhaven, nach und nach eigenständig zu erledigen etc. Dabei lernte ich auch den Leiter den Sozialamtes, Herrn Rentz, kennen, der sich meiner sehr annahm. Ich komme später auf seinen engagierten Einsatz für mich zurück.
Nachmittags bis abends war ich auf der Schulkinderstation unter der Leitung einer Kindergärtnerin – gleich sei es gesagt: Sie war rund 17 Jahre älter als ich – tätig. Die Gruppe bestand aus ca. 12 Jungen im Alter von sechs bis ca. zehn Jahren. Fast alle waren Kinder aus zerbrochenen Familien, z.T. nichteheliche Kinder, ca. 80% von ihnen waren stark lernbehindert. Es war sehr mühevoll und erforderte viel Geduld , nachmittags mit ihnen die Schularbeiten zu erledigen, wofür ich meist eingesetzt war. Aber wir spielten auch draußen, machten Spaziergänge in die Umgebung, und abends wurde vorgelesen und viel gesungen.
In der Erntezeit wurde ich mit Einwilligung des Heimleiters auch für das Treckerfahren, was ich dort lernte, eingesetzt, was mir Spaß machte.
Gelegentlich musste ich auch im Altenheim aushelfen, z.B. Männer baden und einmal bat mich die Stationsschwester, einen Verstorbenen – der in ein Laken gehüllt war – auf dem Buckel die Treppe runter in die Waschküche zu tragen. Das war für mich in Ordnung, und ich war auch stolz darauf.
Nun zu dem Thema Mädchen. Mit Einwilligung des Heimleiters hatten wir jungen Leute dort während meiner Zeit zweimal eine kleine Tanzveranstaltung im Heim arrangiert. Als männl. Personen kamen zwei landwirtschaft. Gehilfen dazu. Brd. Schönau, der das ja genehmigt hatte, kam irgendwann abends – es mochte 23 Uhr gewesen ein, in den Raum und zog mitten im Tanz den Stecker und meinte, es sei spät genug. Widerspruch gab es natürlich nicht.
Und einmal hatte ich mich abends mit einer der Praktikantinnen zum Tanzen in einem Tanzlokal in Cuxhaven-Duhnen verabredet. Als wir beim ersten Tanz auf der Tanzfläche waren, erschien eine andere Praktikantin im Auftrag unserer gemeinsamen Stationsleiterin, die Bescheid wusste, und sagte uns , „Herr Schönau hat davon Wind bekommen“ und wir sollten vernünftiger Weise gleich zurückkommen, damit es nicht noch mehr Wirbel gibt. Wir gingen sofort zurück. Ob Brd. Schönau danach mit mir gesprochen hat, weiß ich nicht. Ich erinnere mich nicht daran.
In der Adventszeit 1954 war es Sitte im Heim unter den Angestellten, dass man ein Los zog – mit einem Namen versehen – und heimlich dem oder der Betreffenden ein „Sternchen“ an die Zimmertür zu hängen. Ich hatte die Praktikantin Gisela Schwarz, die mit mir auf der Schulkinderstation arbeitete, gezogen und hängte ihr abends ein „Sternchen“ an die Zimmertür – immer mit einem Reim auf sie versehen. Es waren schmeichelhafte Reime. So freundeten wir uns an und flirteten miteinander. Ihre Eltern wussten davon und fanden es irgendwie gut. Sie fanden mich nett.
Wir sind nie miteinander ausgegangen und haben uns auch nie heimlich getroffen, auch nicht auf unseren Zimmern. Niemals. Auf der Stationen abends, wenn wir die Kinder in den Schlaf gesungen hatten, hielten wir uns noch ein bisschen im Tagesraum auf, plauderten und scherzten miteinander oder spielten harmlose kindliche Spiele. In der Schlussphase meines Aufenthaltes haben wir uns im leeren Tagesraum manchmal auch harmlos geküsst. Wir waren und blieben während dieser Zeit beide „unschuldig“. Wie altmodisch das heute klingt!
Und doch musste Brd, Schönau, ohne je mit mir darüber Rücksprache gehalten zu haben, irgendeine Nachricht an das Rauhe Haus gegeben haben. Völlig überrascht war ich im Juni 1956, als der berühmte Blaue Bus des Rauhen Hauses vor dem Versorgungsheim parkte, Brd. Füßinger aussiegt und einen jungen Mann mitbrachte, der sich als meinen Nachfolger vorstellte und Brd. Füßinger mich aufforderte, meine Sachen zu packen, er würde mich am nächsten Tag auf den Brüderhof bringen. Keine Vorwarnung, keine Begründung, kein Gespräch!
Ich wurde also abtransportiert!
Auch hier muss abschließend gesagt werden, dass in diesem Jahr seitens des Heimleiters Brd. Schönau keinerlei geistliche Betreuung stattfand.
Brd. Schönau berichtete am 27. Juni 1955 über mich an das Rauhe Haus:
Sehr verehrter lieber Herr Pastor,
in Ihrem Schreiben vom 20. d. M. erbaten Sie einen eingehenden Bericht über Bruder Miecks Führung und Eignung. Sie bekommen in den nächsten Tagen von der Stadtverwaltung Cuxhaven ein ausführliches Zeugnis, zu welchem ich den Entwurf verfasste. Was da nicht drinnen steht und auch nicht stehen sollte, möchte ich nachstehend anführen.
Über Bruder Miecks betontem Hang zur Weiblichkeit war ich von Ihnen unterrichtet worden. Ich freute mich, dass er in den ersten Monaten seines Hierseins in dieser Hinsicht gar nicht auffiel. Nach etwa einem Vierteljahr glaubte ich zu bemerken, dass er sich für eines der hier tätigen acht jungen Mädchen besonders interessierte. Ich redete daraufhin auf ihn ein und es ging wieder gut. Seit Beginn dieses Jahres war jedoch in Mieck ein heftiges Feuer für eine andere Schülerin (Gisela Schwarz) entflammt. Das Verhältnis nahm Formen an, die ich des Öfteren rügen musste. Nach einer sehr ernsten Aussprache Ende März zwischen Mieck und mir schien es so, als nähme er sich meiner warnenden Worte zu Herzen. Es stelle sich jedoch heraus, dass er das Verhältnis zu dem Mädchen nur in der Weise gemildert hatte, dass es im Hause nicht auffiel. Begünstigend für M. war der Umstand, dass die Eltern des Mädchens dieser Freundschaft sehr zustimmten und mein Veto mit dem Einwand zu entkräften suchten „es sei ja alles ganz harmlos“: Mieck hat auch hier gezeigt, dass er sehr leicht entflammbar ist.
Es muß auch noch gesagt werden, dass Br. Mieck anscheinend etwas Organisches mit dem Herzen hat. Er baute hier einige Male ab. Der Heimarzt wollte ihn zur Beobachtung für einige Tage ins Krankenhaus haben. Dazu kam es jedoch nicht. Ein anderer Arzt bescheinigte ihm eine akute Herzmuskelschwäche. Hier dürfte in Zukunft Aufmerksamkeit geboten sein.
Aufs Ganze gesehen war Norbert Mieck ein fleißiger und lerneifriger Mitarbeiter. Er kam in seinen Kenntnissen und Erkenntnissen hier gut voran. Mieck hielt sich an die tägliche Bibellese bzw. an die Losungen und besuchte an seinen dienstfreien Sonntagen den Gottesdienst in der Gemeinde. Am Dienstsonntag ging er häufig mit den Kindern zum Kindergottesdienst. Er verkehrte auch in meiner Familie und benahm sich da immer korrekt.
Ich glaube, dass Mieck seinen Weg machen wird, wenn er gesund bleibt und seine spontanen Herzensneigungen zu zügeln weiß
Mit freundlichen Grüßen Ihr sehr ergebener gez. Brd. P. Schönau
Kurzkommentar dazu meinerseits: „Tägl. Bibellese“ fand nicht statt, Losungen wurden auch nicht vorgelesen. Das wurde von mir auch nicht erwartet oder verlangt.
Es muß noch folgendes hinzugefügt werden: Das Versorgungsheim in Cuxhaven unterstand der Sozialverwaltung der Stadt. Dessen Leiter Wilhelm Rentz hatte sich meiner sehr angenommen, zu ihm hatte ich Vertrauen und konnte ihm auch meine Enttäuschung über die Versetzung zum Brüderhof, die dann ja folgte, mitteilen. Er wandte sich an die Leitung des Rauhen Hauses am 7. Juli 1955 mit folgendem Brief. Ich übernehme den sonst kaum leserlichen Brief wortgetreu:
Cuxhaven, den 7. Juli 1955
Sehr geehrter Herr Pastor,
gestatten Sie mir bitte, dass ich mich in einer privaten Angelegenheit unmittelbar an Sie wende mit der Bitte, mein Anschreiben Dritten, insbesondere Herrn Diakon Schönau gegenüber streng vertraulich zu behandeln.
Zunächst darf ich mich Ihnen gegenüber näher bekannt machen. Ich bin der Leiter der Sozialverwaltung Cuxhaven, die sämtliche sozialen Dienststellen und Einrichtungen der Stadt, u. a. das Städt. Versorgungsheim umfaßt.
Verwalter dieses Heimes ist, wie Ihnen bekannt, der Diakon Schönau, für dessen Wahl ich mich persönlich besonders eingesetzt habe. Es freut mich, Ihnen bei dieser Gelegenheit bestätigen zu können, dass wir auf dem Wege, das Heim durch die Einstellung eines Diakons aus dem Rauhen Haus auf christlicher Basis mit einem gesunden Gemeinschaftsgeist zu erfüllen, bereits erfreuliche Fortschritte gemacht haben.
Und nun komme ich zu dem Grund meines Schreibens:
Der Diakon-Anwärter Norbert Mieck, der dem Städt. Versorgungsheim zur Ausbildung zugewiesen war, hat sich in großer seelischer Bedrängnis an mich gewandt, ihm zu helfen. Er findet offenbar nicht den Mut, sich an seine Vorgesetzten zu wenden. Er kann seine Zurückversetzung in der planmäßigen Ausbildung und seine quasi Strafversetzung zum Brüderhof in Tangstedt nicht überwinden. Er fühlt sich in dieser Angelegenheit durch das Verhalten von Herrn Schönau ungerecht behandelt. Außerdem ist er offenbar den körperlichen Anforderungen auf dem Brüderhof nicht gewachsen und leidet auch darunter, denn er lässt durchblicken, dass er glaubt, dort nicht durchhalten zu können. Ich weiß nicht,. Herr Pastor, ob Ihnen bekannt ist, dass Mieck in unserem Betrieb einen Unfall erlitten hat und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Später wurde er noch mal wegen körperlicher Überanstrengung – wenn ich nicht irre – 3-4 Wochen arbeitsunfähig krank geschrieben . Mir scheint fast, dass er mit Rücksicht auf die vom Arzt festgestellte Herzmuskelschwäche auf dem Brüderhof überfordert wird. Seine seelische Depression beruht darauf, dass er sich zu hart und ungerecht gestraft fühlt, dafür dass er sich nach Ansicht von Herrn Schönau der Praktikantin Schwarz aus dem Versorgungsheim gegenüber – mit der er befreundet ist – nicht korrekt genug benommen habe. Herr Schönau berichtete mir damals die Angelegenheit. Ich lege selbstverständlich auch größten Wert auf ein einwandfreies und gesittetes Verhalten der jungen Leute in unseren Heimen. Dennoch bin ich der Meinung, dass Herr Schönau in diesem Fall übers Ziel hinausgeschossen ist.
Herr Mieck hat mir ausdrücklich versichert, dass seine Beziehungen zu der Praktikantin Schwarz durchaus sauber waren und dass sie den Heimbetrieb niemals gestört haben. Das möchte ich ihm, soweit ich ihn kennengelernt habe, glauben. Herr Schönau dürfte das Verhältnis m.E. falsch beurteilt und gewertet haben, wie mir scheinen will, aus Gründen, die ich Ihnen am liebsten mündlich mitteilen möchte. Ich bin jedenfalls davon überzeugt, dass keine so schwer wiegenden Gründe bestehen. Mieck deswegen in seiner planmäßigen Ausbildung zurück zu setzen.
Das Entscheidende, das ich glaube, Ihnen, Herr Pastor, nicht vorenthalten zu dürfen, ist, dass ihn ernste Zweifel an der Aufrichtigkeit und an der christlichen Einstellung und Gesinnung seiner Vorgesetzten plagen. Ich befürchte ernstlich, dass er nicht durchhält. Ich habe des öfteren Gelegenheit gehabt, Mieck in seiner Arbeit zu beobachten und habe mich oft mit ihm unterhalten. Er hat auf mich einen sehr guten Eindruck gemacht. Es hat mich immer gefreut, dass er sich, von seiner Aufgabe erfüllt, jederzeit vorbildlich eingesetzt hat und alle ihm zugewiesenen Arbeiten, auch die schwierigsten und unangenehmsten, mit Liebe und Eifer erledigt hat. Herr Schönau hat mir dies auch wiederholt bestätigt und Mieck als vorbildlichen Nachwuchs des Rauhen Hauses bezeichnet. Er hat ihn auch des öfteren in seinen Familienkreis aufgenommen. Umso weniger kann ich sein Urteil über Mieck Ihnen gegenüber verstehen.
Ich würde es jedenfalls für einen sehr bedauerlichen Verlust ansehen, wenn Mieck dem Rauhen Haus und damit der christlich-sozialen Arbeit verloren geht. Nach seinem Brief, den er mir geschrieben hat, muß ich dies ernstlich befürchten. Auch aus diesem Grunde halte ich mich für verpflichtet, Ihnen ganz offen zu schreiben und Sie zu bitten, seine Zurücksetzung in der Ausbildung nochmals wohlwollend zu überprüfen.
Falls Sie es wünschen, stehe ich Ihnen zu einer persönlichen Rücksprache in etwa 4 Wochen zur Verfügung, wenn ich ohnehin in Hamburg dienstlich zu tun haben werde.
Mit verbindlicher Empfehlung und vorzüglicher Hochachtung gez. Rentz
Dies alles blieb ungehört. Ich trat meinen Dienst am 26. Juni 55 auf dem Brüderhof an und schieb noch einmal an Herrn Rentz, der sich am 10. Oktober noch einmal an Pastor Donndorf mit Schreiben vom 10. August 55 wandte und wie folgt schrieb:
Sehr geehrter Herr Pastor!
Zunächst bedanke ich mich herzlich, dass Sie meinen Brief vom 7. ds. Mts. sobald beantwortet haben......
Ich sehe durchaus ein, dass Ihre Maßnahmen an sich nicht als eine schwere Strafe angesehen werden kann, und ich bin davon überzeugt, dass Sie diese Zucht in der besten Absicht für ihn anwenden. Sie werden mir aber vermutlich beipflichten, dass wir im täglichen Leben von dem Erfolg noch so gut gemeinter pädagogischer Erziehungsmaßnahmen oft enttäuscht werden. Ich jedenfalls erlebe das in der Erziehungshilfe und Fürsorgeerziehung immer wieder.
Bitte nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich Ihnen offen noch einmal meine ernsten Bedenken hinsichtlich der gegen Mieck getroffenen Maßnahmen wiederhole. Er hat mir noch einmal geschrieben, offenbar, weil ich es ihm – wie gesagt – bei seiner Verabschiedung ausdrücklich nahe gelegt habe. Er teilt mir mit, dass der Arzt ihm dort erklärt habe, er müsse schwere Arbeiten meiden und viel schlafen. Dessen ungeachtet müsse er aber nach wie vor körperlich schwer arbeiten und leide ab und zu unter regelrechten Herzschmerzen, die er früher nicht gekannt habe. Im übrigen müsse er morgens um 1⁄2 5 Uhr aufstehen und komme abends selten vor 21 1⁄2 Uhr ins Bett. Die Mittagspause von einer Stunde reiche ihm nicht zur Entspannung.
Er habe sich nicht an seinen Vorgesetzten gewandt, weil er befürchte, dass der Eindruck entstehen könne, dass er nicht in der Landwirtschaft arbeiten wolle. Solange die von ihm verlangte Arbeit seine Kräfte nicht übersteige, verrichte er sie mit Lust und Liebe. Er glaubt, das in der Landwirtschaft in Cuxhaven bereits bewiesen zu haben (das hat er ! ).
Diese Arbeit gehe aber wirklich über seine Kraft. Jedoch möchte er lieber zusammenbrechen, als um seine Versetzung zu bitten.
Er schreibt weiter, dass er durch die ganze Behandlung (insbesondere von Herrn Schönau), die ihm zuteil geworden sei, die Lust und Liebe zu seinem Beruf verloren habe. Er fragt mich, ob er den Idealismus, mit dem er in den Beruf gegangen sei, wiedergewinnen und ob er auf die Dauer einen Beruf ausüben könne, ohne dazu noch die innere Kraft und das ganze Interesse zu haben. Beides erscheint ihm unmöglich. Durch alle diese Niederschläge habe er jedoch nicht den Glauben verloren. Dennoch sei er sehr ratlos und sehr niedergedrückt. „Führen diese seelischen Konflikte zu einem Chaos oder können Sie mir irgendeinen guten, handfesten und greifbaren Rat geben?“ , fragt er mich.
Sehr geehrter Herr Pastor, ich glaube, der Junge braucht dringend Ihre Hilfe. Es liegt mir völlig fern, Ihre Erziehungsmaßnahmen kritisieren zu wollen. Mir würde es nur unsagbar leid tun, wenn Mieck dem Rauhen Haus verloren geht, was ich allen Ernstes befürchte. Können Sie ihm nicht doch noch einmal eine Chance geben und ihm sein Los erleichtern? Er scheint mir im Nehmen nicht der Stärkste zu sein, und ich glaube, dass durch andere geeignete Maßnahmen bei ihm mehr zu erreichen ist. Ich bin auch überzeugt, dass Sie eine andere Möglichkeit finden werden, dem jungen Mann gerecht zu werden. Darf ich mir erlauben, Sie darum zu bitten? Ich möchte noch einmal betonen, dass ich einen vorzüglichen Eindruck von ihm gewonnen habe und es betrübt mich der Gedanke, dass er der großen Aufgabe verloren gehen könnte und, was noch schlimmer wäre, dass er ein Opponent würde. Er hat mich sogar gebeten, ihm zu helfen, in einen anderen Beruf überzuwechseln. Ich habe das abgelehnt und ihm dringend geraten, unbedingt durchzuhalten. Ich hoffe aber, dass Sie ihm seine Lage etwas erleichtern werden.
Soll ich ihm nun antworten, er möge sich vertrauensvoll an Sie wenden, oder wollen Sie ihn sich nochmals vornehmen? Abschließend darf ich Sie, sehr geehrter Herr Pastor, nochmals darum bitten, diese Angelegenheit aus den in meinem Schreiben vom 7. Juli angegebenen Gründen streng vertraulich zu behandeln.
Mit verbindlichen Grüßen bin ich Ihr sehr ergebener gez. Rentz
(Text aus der Brüderakte kopiert)
Aber nichts geschah!
Pastor Donndorf nahm nie Kontakt mit mir auf.
Und das „vertrauliche“ Schreiben von Herrn Rentz wurde, wie sich aus den Handzeichen – siehe Brüderakte – ergibt, an Brd. Füßinger und Brd. Niemer weitergereicht.
Meine Abordnung zum Brüderhof blieb ehernes Gesetz!
Drittes Jahr der Ausbildung (1955-1956),
(sofern man das als Ausbildung bezeichnen kann)
Brüderhof /landwirtschaftl. Betrieb
Ich wurde am 26. März 1956 zum Brüderhof mit dem blauen Bus des Rauhen Hauses verfrachtet.
Ein Jahr Praktikum auf dem Brüderhof – „Straflager und Vereinsamung“
Nun jedenfalls landete ich im "Straflager" Brüderhof, einem Hof des Rauhen Hauses außerhalb des Dorfes Wilstedt bei Harksheide/Holstein. Heimleiter war Brd. Dückert. Die Unterbringung erfolgte in einer Baracke, die mit selbstgestochenem Torf beheizbar war und aus einem Raum bestand. Untergebracht waren fünf mehr oder weniger junge Männer, die alle in irgendeiner Form behindert waren. Der Älteste, Oskar, war Mitte 40, und er war der Pferdeknecht, was eine Auszeichnung war. Ihn kann man sich nur mit seiner Schiebermütze vorstellen, die er auch nachts aufbehielt. Dann war da Hannes, ein ganz heiterer Bursche, dessen linker Arm gelähmt war. Daher konnte er nur leichtere Arbeit verrichten. Dieter war ein stämmiger und ziemlich schwachsinniger Bursche. Sigurd wiederum war auf eine eigentümliche Weise psychisch eingeschränkt und hatte mehrere Ticks. Schließlich war da noch Heiner, der Jüngste. Er war Pfarrerssohn, ein eher heiterer großer Junge, der einen Sprachfehler hatte und als minderbegabt galt. Deren Eltern mussten für die „betreute Unterbringung“ zahlen, es sei denn, das Soziall- oder Jugendamt leisteten Zuschüsse.
Wir schliefen und aßen alle in diesem einen Raum, der ausgestattet war mit dem Torfofen, einem Tisch und Stühlen und einem Spind für die Kleidung. Die Betten waren aus Metall und mit Strohsäcken und Wolldecken ausgerüstet. Es gab einen Waschraum mit Kaltwasser. Und ein Plumpsklo draußen. Wenn wir uns sonntags mal rasieren wollten, gingen wir in die Hauptbaracke, wo sich die Küche befand und holten uns warmes Wasser. Die Nahrung war karg. Meistens gab es montags Bratkartoffeln mit Buttermilch und dienstags Buttermilch mit Bratkartoffeln usw. Wenn geschlachtet wurde, was wohl nur einmal im Jahr geschah, bekamen wir Wurst. Gelegentlich wurde auch Gemüse dazu gegeben.
Zu dem Hof gehörte eine weitere Baracke, die aber weit besser ausgestattet war als jene, in der ich zusammen mit den Zöglingen untergebracht war. Es gab eine Küche mit Herd und einen Wohnbereich für das Ehepaar Dückert. Außerdem wohnten in einem eigenen Trakt dieser zweiten Baracke ungefähr vier alte Menschen, die mitversorgt wurden.
Schließlich gab es eine Scheune und einen Kuhstall. Auf den Feldern wurden Kartoffeln, Rüben, Mais und Getreide angebaut. Im Kuhstall standen etwa 14 Kühe. Kartoffeln und Gemüse wurden z.T. an das Rauhe Haus geliefert und z.T. verkauft. Die Erträge insgesamt gingen an das Rauhe Haus. Für die untergebrachten Zöglinge, die – wie erwähnt – behindert und auf dem freien Arbeitsmarkt nicht zu vermitteln waren, mussten die Eltern oder die Sozialämter Geld bezahlen, das vermutlich auch an das Rauhe Haus ging.
Ich will einen Tag aus dem Leben auf dem Brüderhof zitieren (festgehalten in meinem Tagebuch vom 6. Januar 1956:
„Morgens stand ich kurz vor 1⁄2 6 Uhr auf zum Melken (natürlich mit der Hand) zusammen mit Dieter, Sigurd und Heinz. Augenblicklich stehen einige Kühe trocken, daher haben wir auch, da wir vier Mann sind, wenig zu melken. Heute früh molk ich Ruth und Sigrid. Nach dem Melken fütterte ich mit Heinz die Kühe: Schrot und Rüben. Um 7 Uhr frühstückten wir, Nach dem Frühstück las ich die Losung (das war mir so von Brd. Dückert aufgegeben). Dann kam Dückert zur Arbeitseinteilung. Ich tränkte zunächst das keine Bullenkalb von Ruth. Das aus den USA gespendete Trockenmilchpulver wurde auf diese Art eingesetzt. Die frisch gemolkene Milch dagegen wurde an eine Molkerei verkauft.
Am Standort der Kuh Ruth stemmte ich ein Loch in den Boden, in das ich einen Ring mit Anker einließ und einzementierte. Dann vom Heuboden Heu losmachen, Stroh schneiden und in den Stall werfen. 2. Frühstück um 9 Uhr, danach Rübenputzen. Zwischendurch wurde ich von Brd. Dückert zu kleineren Arbeiten geholt. Um 1⁄2 12 molk ich wieder Ruth und tränkte das Kalb. Um 12 Uhr aßen wir zu Mittag. Nach dem Essen las ich von Eichendorff „Schloss Durande“ zu Ende und legte mich bis 1⁄2 2 auf den Strohsack. Danach lud ich Rüben auf den Wagen, schälte Tannen, half bei der Jauchepumpe (Brd. Dückert fuhr heute Jauche), um 4 Uhr vesperten wir, danach fütterte ich die Kühe wieder und molk. Gegen 6 Uhr waren wir fertig.“
Eintrag vom 18. Februar 1956: „Heute Gesines (meiner Schwester) Geburts- und Luthers Todestag.
Schnee und Frost bis minus 22 Grad. Zahnpasta und Rasiercreme zugefroren. Waschen: Luxus. Wasserpumpe zugefroren. Vergebl. auf einen Brief von Gisela gewartet. Stallarbeiten und Rübenputzen“.
Es mag genug sein. Klar ist, es war ein äußerst karges Dasein und erinnerte mich manchmal an Krieggefangenenberichte von deutschen Soldaten aus Russland. Natürlich hatten wir es daran gemessen deutlich besser. Aber nochmals: Es gab keine geistliche Betreuung. Ich durfte nur die Losung lesen. Und ganz selten kam es vor, dass wir mit dem Pferdewagen nach Tangstedt zu einem Gottesdienst fuhren. Selten kam Brd. Dückert sonntags in unsere Baracke, las aus der Bibel vor und sprach ein Vaterunser. (nachträgl. angemerkt sei: irgendeine geistliche Betreuung oder ein persönliches Gespräch gab es nie.)
Dass ich als schmaler Jüngling, bei bescheidener Kost und schwerer körperlicher Arbeit – gemolken wurde von Hand – sowie fast seelischer Auszehrung litt, ist wohl überzeugend.
Im Sommer 1955 während der Getreideernte brach ich oben auf dem Erntewagen zusammen. Mir wurde schwindlig und schwarz vor Augen, und ich fiel vom Erntewagen und blieb auf dem Boden liegen. Brd. Dückert veranlasste wohl – bewusst habe ich das nicht mitbekommen –, dass ich mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus Bad Oldesloe gefahren wurde. Ich wurde untersucht, lag dort sechs lange Wochen (und ich muss es mal so hart ausdrücken: Kein Arsch aus dem Rauhen Haus besuchte mich). Weder der Hausvater Br. Dückert, noch die Herren aus dem Rauhen Hause: Donndorf, Füßinger, Niemer oder sonst wer. Ich hatte in diesen fast sieben Wochen keinerlei Besuch. Man benachrichtigte auch nicht meine Eltern. Ich war schließlich damals noch minderjährig! Bei meiner Entlassung sagte mir der seinerzeit dort tätige Chefarzt Prof. Dr. Hangarter, ich hätte ein nervöses nicht-organisches Herzleiden, das seinen Ursprung wohl in seelischen Konflikten hätte. Wörtlich sagte er, auf dem Brüderhof würde ich „wohl zugrunde“ gehen. Er riet mir sogar, aus der diakonischen Arbeit zu gehen. Entsprechendes wird er dann dem Rauhen Haus mitgeteilt haben. Jedenfalls rief der Chef des RH, Pastor Donndorf, mich zu sich nach Hamburg und veranlasste eine Nachuntersuchung beim RH-Hausarzt Dr. Horeis, der mich für eine „leichte Arbeit“ auf dem Brüderhof für geeignet hielt. Mithin kehrte ich wider Erwarten auf den Brüderhof zurück und vollendete mein Strafjahr , die Arbeit war nicht leichter, aber an der einen oder anderen Stelle übersah ich nicht, dass Brd. Dückert mich schon mal – z.B. beim Torfstechen – früher als andere in die Baracke schickte, ich könne ja schon mal den Torfofen anheizen.
Tagebucheintrag vom 28. Februar 1956: „In der letzten Zeit habe ich mich häufig mit dem Gedanken beschäftigt, aus dem RH auszutreten und zu den Soldaten zu gehen. Dass ich nie ein echter Diakon werden kann, ist mir längst klar. Was habe ich hier draußen wirklich vom Leben? Von den paar Pfennigen Taschengeld kann ich mir nur Seife, Rasierklingen und Tabak leisten. Freizeit gibt es nicht ....“
Tagebucheintrag vom 1. März 1956 (irgendwie noch mein Geburtstag):
„Es ist 10 Uhr abends, ich sitze hier im Bienenkorb (Baracke), während die anderen schon im Bett liegen und ihr wohliges Grunzen hören lassen. Der Chef ist heute nicht da, und es wird einige Zeit dauern, bis er kommt. Um kurz vor 6 Uhr hat Ruth gekalbt, ein kleines, sehr schmächtiges Bullkalb. Ich kann Ruth noch nicht melken, da die Nachgeburt noch nicht raus ist. So muss ich noch warten, und das kleine Kalb muss ja noch zu saufen haben
Gestern am 29. Februar (mein Geburtstag) gab`s wieder viel zu tun. Vier Schweine wurden geschlachtet. Ich merkte den ganzen Tag kaum, dass ich wirklich Geburtstag hatte. Zum Glück bekam ich sehr viel Post. Gisela hatte mir ein nettes Päckchen mit einer Buchhülle und Zigaretten zurecht gemacht. Das Rauhe Haus hatte nicht mal einen Kartengruß übrig!“
Ich hatte immer noch die Idee, aus dem RH auszutreten, entweder Soldat oder Seemann zu werden. Ein herzerweichender Brief meiner Mutter aus jener Zeit bewog mich, die Ausbildung im RH weiterzumachen.
Im März 1956 wurde ich ins Rauhe Haus zurückgerufen und durfte nun mit der regulären Ausbildung beginnen.
Abschließend schrieb Brd. Dückert folgenden Bericht über mich:
Brüderhof, im März 1956
Bericht über Bruder M i e c k
Brd. Mieck, geb. 29.2.1936 ist seit dem 26.5.1955 hier auf dem Brüderhof als Gehilfe tätig. Es fiel ihm zuerst schwer hier Fuß zu fassen, denn die hier anfallenden Arbeiten waren ihm nicht nur fremd, sondern er war ihnen auch körperlich nicht gewachsen. Hinzu kam noch, dass er als Bruder allein war und keinen Gleichaltrigen hatte mit dem er Freud und Leid teilen konnte.
Mit den Jungen wurde er gut fertig und er gab sich redliche Mühe, seine ihm gestellten Aufgaben zu erfüllen. Leider hat er dabei sein ohnehin schon schwaches Herz überanstrengt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.
Am 27.8.55 (mitten in der Erntearbeit) brach er während der Arbeit zusammen und musste nach Bad Oldesloe ins Kreiskrankenhaus geschafft werden. Am 14.10. wurde er dort wieder entlassen und trat einen ärztl. verordneten Erholungsurlaub an.
Nach Beendigung des Urlaubs fing Brd. Mieck wieder an, leichte Arbeiten zu verrichten und blieb dabei unter ärztl. Kontrolle. Seine ihm aufgetragenen Aufgaben hat er stets zur Zufriedenheit erledigt und hat dabei mehr und mehr vollbracht als ihm anfänglich zugetraut wurde. Mit den Jungen weiss er gut umzugehen und hält Ruhe und Ordnung in der Fa. Bienenkorb.
Während des Winters hat sich Brd. Mieck gut erholt und er müsste m.E. bevor er den Brüderhof verlässt noch mal gründlichst untersucht werden.
Gez. F. Dückert“
Bemerkung dazu: Hier ist ziemlich geschönt worden. Mir wurden bis auf ein oder zwei Ausnahmen niemals Erleichterungen eingeräumt. Ich habe weiterhin Kühe gemolken, im Torf gearbeitet, einmal nachts allein einer Kuh beim Kalben geholfen, bin Trecker gefahren und musste mit den Zöglingen, die Dückert „Jungen“ nennt (der älteste war Mitte 40 und schlief immer mit der Mütze auf dem Kopf), die anfallenden Arbeiten gemeinsam angehen.
Auch in diesem Jahr blieb unklar, was ich oder was ich nicht werden wollte oder konnte. Mein religiöses Gefühl, meine religiösen Überzeugungen trugen nicht mehr. Mir ging es nur noch darum, einen Beruf zu ergreifen. Und so entschloss ich mich, da ich kaum eine andere Wahl, die einigermaßen realistisch erschien, hatte, die noch vor mir liegenden vier Jahre im Rauhen Haus durchzustehen und mich zum Diakon und Sozialarbeiter ausbilden zu lassen. Die Ideen, vom Brüderhof wegzugehen und Seemann oder Polizist zu werden oder gar zur Bundeswehr zu gehen, waren in Verzweiflungsstunden aufgekommen.
4. bis 6. Jahr der Ausbildung 1956 bis 1960
Zu Beginn der regulären Ausbildung wurde ich der Familie Schönburg zugeteilt und war dort Gehilfe. Der Familienleiter war ein Bruder, der sich in der letzten oder vorletzten Klasse der Ausbildung befand. Wir hatten ungefähr zwölf Jungen zu betreuen, die in die ersten drei Klassen der Grundschule gingen. Wir weckten sie, nahmen die Mahlzeiten mit ihnen ein und begleiteten sie z.T. auf dem Schulweg. Nachmittags halfen wir ihnen bei den Schularbeiten und machten dann Spiele mit ihnen.
Der Brüderunterricht gestaltete sich in diesem ersten regulären Ausbildungsjahr unkompliziert und z.T. auch gewöhnungsbedürftig. Wir waren zehn junge Männer in diesem Durchgang und hatten Fächer wie Deutsch, Mathematik und Literatur, dann aber Neues Testament, Altes Testament, Dogmatik, Diakonie-Geschichte und Recht. Die Dozenten waren naturgemäß unterschiedlich, die einen sehr fromm und dogmatisch, die anderen interessant. Hervorheben möchte ich den jungen Pastor Krüger, der Neues Testament und z.T. auch Literatur unterrichtete. Er war rhetorisch gewandt und lebenserfahren. U.a. erzählte er auch aus seiner Zeit an der Front, wo er den Dichter Wolfgang Borchert kennen gelernt hatte und nach dessen frühem Tod seine alte Mutter besuchte und ihr von seinen Begegnungen mit ihrem Sohn berichtete. Von Pastor Krüger lernte ich auch zw. wirklicher Literatur und Kitsch zu unterscheiden.
Er sagte u.a. „Über ein Klosett kann man auch so schreiben, dass es Literatur ist oder eben auch völlig banal“.
Krüger berichtete auch einmal aus der Frühgeschichte der Brüderschaft, als eingesegnete Brüder auch noch als Missionare in afrikanische Länder geschickt wurden. Sinngemäß sagte er: Und dann brauchten die ja auch in biblischer Tradition eine Frau. Und man suchte unter den Frauen, die in der Küche des RH arbeiteten oder sonst, jedenfalls eine, die die Leitung des RH für geeignet hielt, schickte sie dem Bruder hinterher „wie man eine Kuh zum Bullen führt“. Ja, Krüger hatte insgesamt auch eine kritische Einstellung zu den Gepflogenheiten des RH.
Nach einigen Monaten wollte der Erziehungsleiter, bei dem jeden Morgen alle Fragen und Vorkommnisse aus den Familien besprochen und Entscheidungen getroffen wurden, mich von der Schönburg in das Haus Kastanie versetzen, wo größere Jungen und wohl auch etwas schwierigere zu einer Familie zusammengefasst waren.
Er begründete das vor allen Versammelten damit, dass er meinte, „Mieck ist aus härterem Holz geschnitzt“ als der bisherige Gehilfe. Und fortan begleitete ich dann die etwa 12- bis 14-jährigen Jungen, deren Schularbeiten ich begleitete und danach Freizeitbeschäftigung anbot. Ich wunderte mich, dass der mich mit härterem Holz verglich gegenüber einem Mitbruder.
Von den harten Arbeiten auf dem Brüderhof hatte ich mich inzwischen erholt, nahm gern an dem Unterricht teil, der immer vormittags stattfand, während die Jungen in der Schule waren, die wir morgens geweckt hatten und mit ihnen zum Frühstücken waren.
Wenn abends – schätzungsweise gegen 22 Uhr – die Jungen in den Betten lagen , konnten wir Brüder uns noch mal mit den Themen aus den Unterrichtseinheiten beschäftigen, allerdings nur, wenn wir nicht zu müde waren. Der Tag war vom Aufstehen bis zum Schlafengehen durchweg ausgefüllt.
Im zweiten Jahr der regulären Ausbildung hatten wir vorwiegend Unterricht in den Fächern, die zum Sozialarbeiter-Abschluss führen sollten. Hervorheben möchte ich hier den Erziehungswissenschaftler Höllenriegel, der durch und durch Pädagoge war. Er ließ uns gleich zu Anfang einen Pädagogen wählen, mit dem wir uns das ganze Jahr über vornehmlich beschäftigen sollten. Ich wählte J.J. Rousseau und die Lehre aus dem „E ́mile“. Darüber musste ich dann ein Referat halten und bei allgemeinen Diskussionen in diesem Fach auch eine entsprechende Position, die aus den Lehren Rousseaus herzuleiten war, einbringen. So auch die anderen Brüder unserer Klasse (wir waren zehn) Ihre jeweiligen Positionen.
Und Höllenriegel brachte uns strenges wissenschaftliches Arbeiten bei, was mir sehr viel Freude bereitete und mir bei späteren Aufgaben nach der Ausbildung weiterhalf.
Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass uns der Psychologie-Dozent tatsächlich noch die Typenlehre nach Kretschmer beibrachte, die – wie ich später erfuhr – von den Nazis für ihre Rassenlehre in Anspruch genommen worden war. Und – dies sei vorweggenommen – ich wurde in der mündlichen Psychologieprüfung 1959 vor der versammelten Prüfungskommission, in der Theologen, Sozialwissenschaftler usw. saßen, aufgefordert, diese Typenlehre darzustellen. Meine Leistung wurde für gut befunden, niemand fragte nach. Ich glaube, die Leute waren noch total ahnungslos.
1957 oder 1958 wurde mir die Leitung der „Krankenstube“ übertragen. Hier konnten sich alle Zöglinge, die Erkältungen hatten oder sonst wie krank waren, erst einmal versorgen lassen. Ich durfte leichte Medikamente ausgeben, Wunden versorgen etc. Bei ernsthafteren Erkranungen unterrichtete ich den Kinderarzt, der dann in die Krankenstube kam. Die Krankenstube verfügte auch über ungefähr acht Betten für Jungen, die auf Anordnung des Arztes Bettruhe brauchten. Ich gab ihnen ihre Medikamente und maß Fieber. 1958 brach eine Grippeepidemie aus. Die Betten in der Krankenstube reichten nicht aus. Der Wichernsaal wurde geräumt, und es wurden 1-stöckige Betten aufgestellt. Ich schätze, dass ich in der Spitzenzeit 35 bis 40 kranke Jungen dort liegen hatte und sie versorgen musste, das hieß z.B. morgens sehr früh bei allen Fieber messen , den jeweiligen Zustand notieren, mit dem Arzt telefonieren, der dann irgendwann anreiste, von der Küche das Essen für alle Jungen heranholen etc. Am Unterricht konnte ich während dieser Epidemie nicht mehr teilnehmen. Hilfe bekam ich nur, wenn neue Betten aufgestellt werden mussten. Ich fühlte mich von der Anstaltsleitung ziemlich allein gelassen. Einmal am Tag erschien Bruder Niemer, der sozusagen die Oberaufsicht über die Krankenstube und das Altenheim hatte. In dieser Zeit magerte ich ziemlich stark ab.
Ich weiß nicht mehr genau, wie lange diese Epidemie andauerte.
Im Zuge der weiteren Ausbildung zum Sozialarbeiter leisteten wir zwei Praktika bei Behörden ab. Das war für mich sehr lehrreich. Ein Praktikum absolvierte ich in der Sozialabteilung der Ortsamtes HH-Billstedt und lernte dort, die Fürsorgepflichtverordnung (Vorgängerin des BSHG) anzuwenden und mit Hilfsbedürftigen umzugehen. Das zweite Praktikum durchlief ich in der Jugendhilfsstelle des Jugendamtes, das sich um in Hamburg aufgegriffene minderjährige Jugendliche kümmerte, die z.T. vorübergehend in der geschlossenen Abteilung „Hütten“ untergebracht waren. Es galt zu klären, ob die Erziehungsberechtigten den Verbleib in Hamburg unterstützten. Anderenfalls mussten sie von der Jugendhilfsstelle an ihren Heimatort zurückgebracht werden. Ich hatte einmal das Vergnügen, einen Jugendlichen zur Weihnachtszeit ins Rheinland zurück zu begleiten und konnte bei der Gelegenheit ein paar Tage zu Weihnachten bei meinen Eltern und Geschwistern sein. Aber der Jugendliche ist mir auf der Hinfahrt entwischt.
Nach diesen Praktika und weiterem Unterricht legten wir die Prüfung zum – wie es damals noch hieß: Wohlfahrtspfleger ab (heute Sozialarbeiter).
Auch in dieser Zeit gab es keine geistliche Betreuung oder das Angebot zu persönlichen Gesprächen. Inzwischen hatte man sich daran gewöhnt, und der Zusammenhalt unter den Klassenkameraden war recht gut.
Das letzte Jahr der Diakonenausbildung war zweigeteilt: Vormittags fand Unterricht in biblischen Fächern und in dem Fach Verwaltung statt. Am Nachmittag leistete man ein Praktikum in einem der diakonischen Arbeitsfelder, für mich war es der Einsatz in der Hamburger Kirchgemeinde St. Georg, wo ich Kinder- und Jugendlichen-Arbeit machte, Veranstaltungen mitorganisierte, an Gottesdiensten teilnahm u.ä.
Im Unterricht begeisterte ich mich für den Hauptpastor Dr. Hartmut Sierig, ein noch junger Dozent, der als einziger frischen Wind in die Ausbildung brachte. Er lehrte u.a. mit Begeisterung „Öffentlichkeitsarbeit“ und brachte Beispiele aus seinem eigenen Leben. Außerdem war er ein hervorragender Rhetoriker. Leider ist er als noch recht junger Mann kurz nach Beendigung unserer Ausbildung an Leukämie gestorben.
Examen 1960. Mein Weg stand für mich fest: Obwohl ich sofort eine Diakonenstelle in St. Georg mit einer 4-Zimmer-Dienstwohnung angeboten bekam und gleich ins Beamtenverhältnis übernommen worden wäre, war mir klar, dass dies nicht mehr mein Weg sein konnte. Es zündete nichts Religiöses mehr in mir. Ich wollte aus meinem Leben etwas machen. Daher bewarb ich mich bei der Hamburger Sozialbehörde und begann am 1. April 1960 als Angestellter in der behördlichen Gefährdetenhilfe und wohnte bei einem Klassenkameraden zur Untermiete. Mein weiterer beruflicher Weg war durch den Willen zu einem selbst gestalteten Leben außerordentlich erfolgreich.
Von 1967 bis 1970 absolvierte ich einen berufsbegleitenden Studiengang an der Akademie für Jugend- und Sozialarbeit in Frankfurt/M. für moderne methodische Sozialarbeit und Supervision, bekam danach neben meiner hauptberuflichen Arbeit als Leiter der Sozialtherapeutischen Dienste (dort war ich Chef von 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern) einen Lehrauftrag an der Hamburger Fachhochschule für Sozialpädagogik, der 1980 in eine Professur mündete, die ich bis zu meiner Pensionierung 20 Jahre lang inne hatte. Nebenher hatte ich weitere Lehraufträge an der Uni Rostock, der Apollonhochschule für Gesundheit in Bremen sowie an der Ev. Fachhochschule des Rauhen Hauses und gab Supervisionen und führte Fortbildungen durch.
Ehrungen
Abschließend will ich nicht unerwähnt lassen, dass ich im Jahr 2000 vom Diakonischen Werk Hamburg das Kronenkreuz in Gold für „allen Einsatz in der Diakonie der Kirche“ verliehen bekommen habe (ich war 25 Jahre lang stellvertretender Vorsitzender des Altenheimes St. Johannis Hamburg) sowie ebenfalls im Jahr 2000 die Ehrenmedaille der Fachhochschule Hamburg für besondere Verdienste und schließlich am 28. Mai 2002 die „Medaille für treue Arbeit im Dienste des Volkes in dankbarer Anerkennung seiner Verdienste für treue Arbeit im Dienste des Volkes“ – überreicht vom damaligen Hamburger Ersten Bürgermeister der Stadt Hamburg, Ole von Beust.
2014 trat ich aus Überzeugung aus der Brüder- und Schwesternschaft des Rauhen Hauses aus, weil ich dort nie eine Heimart gefunden hatte.
Zurück zur vorherigen Seite